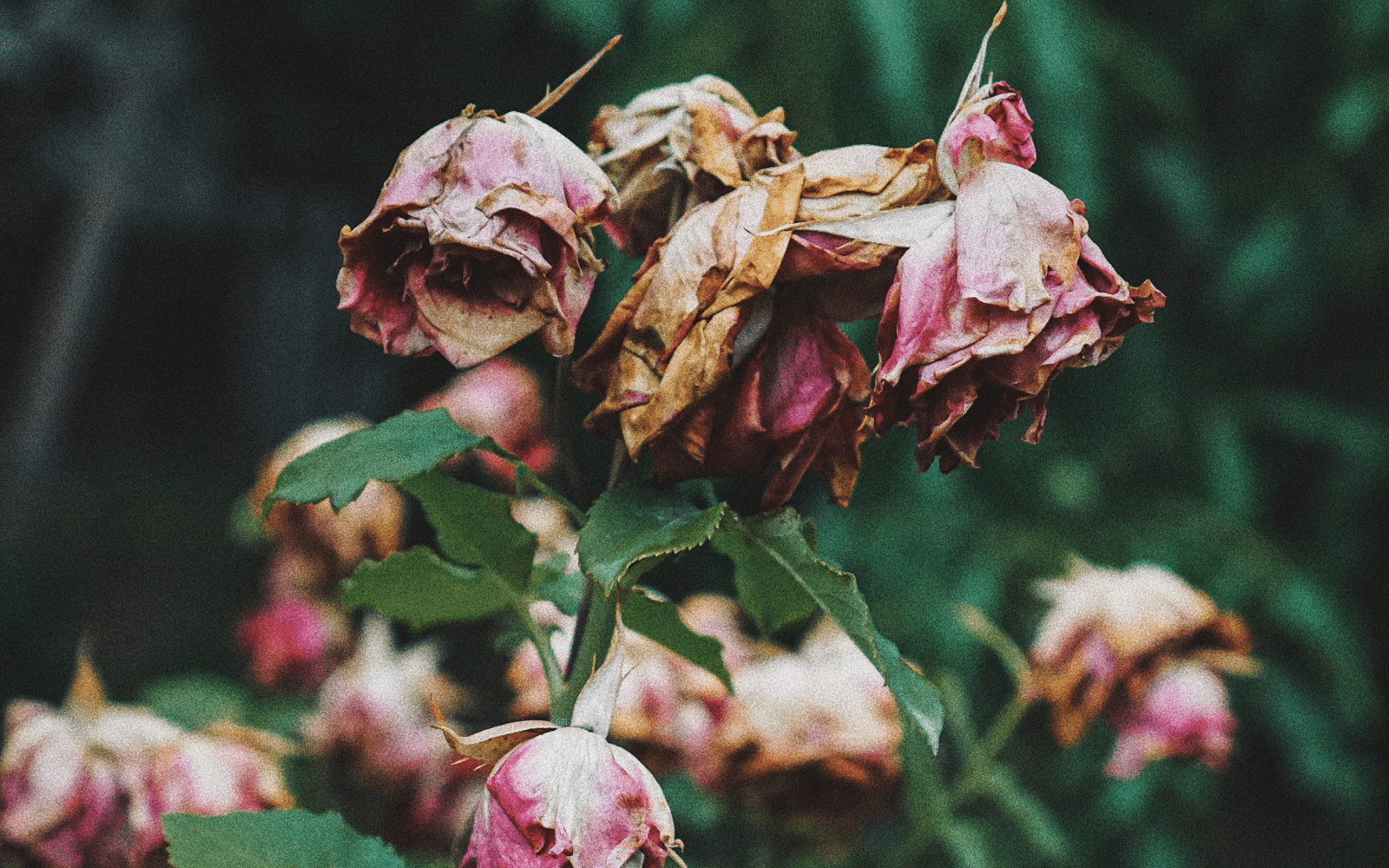Christinnen und Christen sind berufen, die gute Nachricht von Jesus so weiterzuleben und weiterzusagen, dass andere sie als befreiend, verändernd und lebensbringend erfahren. Durch alle Zeiten hindurch bedeutete das: Wir sind herausgefordert, im Dialog mit einer sich ständig wandelnden Kultur zu stehen und sensibel für gesellschaftliche Entwicklungen zu sein.
Im Gespräch mit Menschen unterschiedlichster Weltanschauungen begegnet mir dabei eine gravierende Herausforderung: Das Eu-angelium ist in den Ohren und Augen vieler Menschen zum Dis-angelium geworden. Die Gute Nachricht wird als schlechte Nachricht wahrgenommen. Und zwar in drei großen Bereichen:
1. Emotional
„Ich habe alles: eine tolle Familie, einen guten Job, ein schönes Haus, Hobby und Reisen – ich bin erfüllt und glücklich. Ohne Religion!“, sagte mir ein Bekannter.
Der Sinn des Lebens, so die weitgehend einhellige Meinung der meisten Zeitgenossen, ist es, glücklich zu sein. Zum Glück führen verschiedene Wege: Selbstverwirklichung, Karriere, Familie, soziales Engagement, Abenteuer, Fitness, Achtsamkeit … Gott dagegen ist für das persönliche Glück überflüssig. Etliche Menschen halten Religion sogar für schädlich, weil sie einengt und die persönliche Entfaltung behindert.
2. Intellektuell
„Warum soll ich an einen Gott glauben, dessen Existenz so unwahrscheinlich ist wie die Existenz einer fliegenden Untertasse?“, fragte mich eine Studentin der Physik an einer deutschen Universität. Die Grundüberzeugung unserer Gesellschaft ist, dass die (Natur-)Wissenschaft die Religion im Allgemeinen und das Christentum im Besonderen widerlegt hat. Feuerbachs These vom Glauben als illusorische Projektion wird von den meisten meiner Diskussionspartnerinnen und -partner unhinterfragt vorausgesetzt. Gläubige gelten vielen als voreingenommen, unwissenschaftlich und intellektuell unredlich. Bestenfalls ist der Glaube für denkende Menschen irrelevant; schlechtestenfalls wird er als faktenfeindlich und wissenschaftsschädlich wahrgenommen.
3. Moralisch
An einer anderen deutschen Universität wurden vor einigen Wochen Flyer verteilt, auf denen vor den Christen an der Uni gewarnt wird, weil diese „restriktive Moralvorstellungen durchsetzen wollen und einen Angriff auf die Freiheiten darstellen, die in den letzten Jahrzehnten […] erkämpft wurden.“
Längst haben Christinnen und Christen in den Augen ihrer Mitmenschen nicht mehr eine überhöhte Moralvorstellung, die man sowieso nicht einhalten kann, weshalb man es gar nicht erst versucht. Für viele Zeitgenossen verkörpert das Christentum mittlerweile im Gegenteil eine schlechte Moral, deren Auswirkungen sich in Geschichte und Gegenwart zeigen. Christen gelten als heuchlerisch, arrogant, homophob und frauenfeindlich; sie missbrauchen Kinder und Macht und sind verantwortlich für Religionskriege und Korruption. Für die Gesellschaft und den Einzelnen wäre es daher besser, wenn der Einfluss des Christentums auf ein Minimum reduziert werden könnte.
Zusammenfassend: Aus der Sichtweise vieler meiner Gesprächspartner ist das Evangelium für den Einzelnen und die Gesellschaft emotional irrelevant, intellektuell minderbemittelt und moralisch fragwürdig – mit anderen Worten: weit entfernt davon, Gute Nachricht zu sein.
Nun könnte man einwenden, dass das nichts Neues ist. Schon Paulus weiß im 1. Korintherbrief, dass Christus den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit ist (1. Korinther 1,23). Neu ist aber meines Erachtens, dass der Inhalt des folgenden Verses nicht mehr zutrifft: Für Christinnen und Christen scheint Christus oft weder Gottes Kraft noch Weisheit mehr zu sein (vgl. 1. Korinther 1,24). „Ich fühle mich manchmal, als sei ich gebrainwashed worden. Als hätte ich eine ansteckende Krankheit, die ich möglichst gut verbergen muss“, gestand mir ein junger Mann, seit Jahren Christ.
Vielleicht können manche für sich persönlich benennen, was das Gute an der Guten Nachricht ist. Aber warum sie auch für andere und für die Gesellschaft gut sein soll, darauf haben viele Christinnen und Christen keine Antwort.
Das bedeutet: Um den Glauben weiterzugeben, fehlen Grund und Motivation.
Gleichzeitig hat sich die vom Philosophen Jean-François Lyotard diagnostizierte Skepsis des postmodernen Menschen gegenüber den Metaerzählungen – den großen Ideologien, Religionen und Institutionen – verstärkt und ist zu einem breiten Misstrauen gegenüber Expertinnen, Autoritäten und der Öffentlichkeit im Allgemeinen angewachsen (vgl. zum Beispiel die Vertrauenskrise von Politik und Journalismus). Einer Studie im Auftrag von Lithium Technologies von Januar 2016 zufolge vertrauen nur 29 % der deutschen Konsumenten beim Produktkauf der Empfehlung von Werbung oder Social Media, während das Vertrauen zu Freunden und Verwandten bei 81 % liegt. Die Verfasser der Studie kommen zu dem Ergebnis, dass die „Empfehlungsmacht“ von Menschen aus dem Umfeld riesig ist. Für das Einladen zum Glauben bedeutet dies, dass die wichtigsten Zeuginnen und Zeugen nicht Pfarrerinnen und Pastoren sind, sondern Physikerinnen und Raumpfleger, Friseusen, Lehrerinnen und Automechaniker und dass die entscheidende Verkündigung im Gespräch in der Kneipe, auf einer Zugfahrt oder am Arbeitsplatz stattfindet.
Das heißt nicht, dass ich die Weitergabe des Glaubens durch Kleingruppen oder öffentliche Verkündigung für unwichtig erachte. Alle drei Formen des Weitersagens sind biblisch belegt und bis heute relevant. Dass aber beispielsweise Menschen an einem christlichen Anlass teilnehmen, obwohl sie sich als eher religiös unmusikalisch bezeichnen, bewirkt die „Empfehlungsmacht“ der christlichen Alltagszeuginnen und -zeugen.
Was heißt das für die Evangelisation?
Es gilt, neu zu entdecken, was im 21. Jahrhundert das Gute an der Gute Nachricht ist. Warum ist diese Botschaft nicht nur nicht irrelevant, sondern die beste Nachricht für das Individuum und die Gesellschaft unserer Zeit?
Um dem nachzuspüren, brauchen wir zum einen Demut. Wir müssen uns fragen: Was können wir von der negativen Wahrnehmung lernen? Wo hält sie uns einen Spiegel vor? Wir sollten gute Zuhörerinnen werden, andere Weltanschauungen und Meinungen wertschätzen – was ist das Gute an ihrer Nachricht? – und lernen, gute Fragen zu stellen (das besonders).
Zum anderen brauchen wir Mut. Der Psychologe und Autor Glynn Harrison sagt: „We need to tell the better story“ – wir müssen die bessere Geschichte erzählen und diese für Christinnen und Christen (und andere) erlebbar machen, um ihnen so zu helfen, sprachfähig zu werden über die Schönheit, die Wahrheit und die Kraft des Evangeliums für unsere Gesellschaft.
Dazu nun einige Gedankensplitter zum Weiterdenken:
1. Die Schönheit des Evangeliums: Warum ist die Guten Nachricht moralisch gut?
Ein Freund erzählte mir von dem Druck, eine Partnerin zu finden. „Mein Gefühl ist, dass unsere Gesellschaft Status und Identität stark über Sexualität und Partnerschaft definiert.“
Im weiteren Verlauf des Gesprächs sagte ich, dass unsere Gesellschaft Sexualität aus christlicher Sichtweise heraus nicht zu sehr, sondern zu wenig wertschätzt und dass diese viel kostbarer ist, als unser Umgang damit oft vermuten lässt. Denn Sexualität spiegelt Gott und seine bedingungslose, sich verschenkende Liebe zu uns wider. Ich erzählte ihm, was es für mich bedeutet, dass meine Identität in dieser Liebe begründet ist. Daraufhin sagte er tief bewegt: „Das ist das Schönste, was ich je gehört habe.“
Das Evangelium ist gute Lebensnachricht für den Einzelnen. Es ist aber auch eine Botschaft, die befreiendes, versöhnendes Potenzial für die ganze Gesellschaft hat. Ich wünsche mir, dass wir neu das Prophetische des Christentums entdecken, dass wir uns mit aktuellen gesellschaftlichen Themen wie künstliche Intelligenz, Gentechnik und Digitalisierung beschäftigen und in diesen Diskussionen das Evangelium aufstrahlen lassen.
William Falk, der Chefredakteur der amerikanischen Wochenzeitschrift The Week, beklagt in der Ausgabe vom 21.12.2018 die systematische Desinformation, durch die zum Beispiel Trump und Putin alternative Fakten zu ihren Gunsten präsentieren. Er beschließt seinen Leitartikel mit den Worten: „This may be foolishly optimistic, but my wish for 2019 is that the word of the year will be: ‚Truth.‘“
Noch vor wenigen Jahren wäre ein solches Bekenntnis zu objektiver Wahrheit in intellektuellen Kreisen kaum denkbar gewesen. Wir erleben zunehmend die gesellschaftlichen Konsequenzen des Relativismus und merken, dass er am Ende eben nicht dazu führt, dass unrechtmäßige Machtansprüche unterbunden werden, wie es die postmodernen Kritiker intendiert hatten, sondern im Gegenteil: Die Starken, Lauten setzen sich mit ihrer Wahrheit auf Kosten der Schwachen, Leisen durch. Die für eine funktionierende Demokratie so wichtige Diskussionsgrundlage wird untergraben. Die Zersplitterung der Gesellschaft und die Verhärtung der Fronten wird dadurch weiter verschärft, dass es ohne Wahrheit kein Schuldeingeständnis geben kann, was wiederum Versöhnung fast unmöglich macht.
Gleichzeitig können und wollen wir nicht zurück hinter die postmoderne Kritik der Verbindung von Wahrheit und Macht: „Wer Macht hat, definiert, was ,wahr‘ ist, und wer definiert, was ,wahr‘ ist, hat Macht.“
Wie könnte ein dritter Weg aussehen? Wir Christinnen und Christen erzählen von einem, der sagt: „Ich bin die Wahrheit.“ Wenn die Wahrheit eine Person ist, hat das weniger mit einem Machtanspruch zu tun, sondern vielmehr mit Wahrhaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit, welche sich in Beziehung erweist.
Jesu Wahrheit zeigt sich in Ohnmacht und wird erst dadurch zur Vollmacht. Es ist also eine Wahrheit, die nicht machtvoll daherkommt und die nicht auf Kosten der Liebe ausgelebt werden kann. Im Gegenteil: Wahrheit und Liebe bedingen sich bei Jesus gegenseitig und sind die zwei Seiten der Gnade. In der Begegnung mit Jesus wird Menschen klar, wo ihr Leben brüchig ist und nicht der göttlichen Wahrheit entspricht. Ihre eigene Zerbrochenheit können sie sich aber nur eingestehen, weil Jesu gnädiger Blick auf ihnen ruht und sie von der göttlichen Liebe verändert werden. So wird Versöhnung möglich – heilende Botschaft für eine Gesellschaft, die ihren Zusammenhalt zu verlieren droht, weil immer mehr Gruppen sich über ihr empfundenes oder reales Opfersein definieren und die anderen in Freund und Feind aufteilen.
Einer meiner theologischen Lehrer sagte es einmal so: „Nicht wir haben die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat uns. Unsere Wahrheit hat nicht recht, sondern lieb. Das ist recht und das verändert.“
Das personale Verständnis von Wahrheit und das uns gebotene demütige, liebende Anbieten dieser Wahrheit ist versöhnende Nachricht für die Diskussionskultur einer Gesellschaft, die die Macht der Wahrheit genauso fürchtet wie die Macht des Relativismus. Dazu gehört auch (darauf sei hier nur ganz kurz verwiesen): „Telling the better story“ heißt „living the better story“. Dass Wort und Tat zusammengehalten werden, erscheint mir heute wichtiger denn je!
2. Die Wahrheit des Evangeliums: Warum ist die gute Nachricht intellektuell inspirierend?
Warum ergibt die christliche Weltanschauung im Licht der Fakten mehr Sinn als andere Weltanschauungen? Diese Frage zu beantworten ist eine herausfordernde Aufgabe, der wir uns beim Pontes Institut in besonderem Maße widmen.
Christliche Weltanschauung verbindet Glauben und Denken, weil es sich eben nicht um blinden Glauben handelt, sondern um gut begründetes Vertrauen. „Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand“ bedeutet doch: Wir können Gott auch mit der Wissenschaft ehren und dabei seine Gedanken nachdenken, wie es Johannes Kepler sinngemäß gesagt hat.
Wir brauchen dazu eine Stärkung der Apologetik. Damit meine ich nicht eine falsch verstandene Apologetik, die Gott beweisen oder ihn komplett mit dem Verstand erfassen will. Natürlich übersteigt Gott unseren Verstand; er geht über ihn hinaus. Das bedeutet aber nicht, dass er konstant dahinter zurückbleibt. Wenn es stimmt, dass Jesus die Wahrheit ist, dann hält er jeder Anfrage stand. Dann dürfen wir fragen und zweifeln.
Apologetik ist darum auch Seelsorge des Denkens. Argumente können helfen, Stolpersteine auf dem Weg zum Glauben zur Seite zu räumen und Vorurteile zu hinterfragen. Natürlich ist das Zum-Glauben-Kommen Wirken des Heiligen Geistes. Dass der Geist aber auch intellektuelle Argumente verwenden kann, sollten wir ihm nicht verwehren. Apologetik heißt darum vor allem, sprachfähig zu sein in den relevanten Fragen unserer Gesellschaft; mit der Kultur, ihren Denkerinnen und Denkern und prägenden Strömungen in den Dialog zu treten.
Das bedeutet für uns, dass wir nie ausgelernt haben, dass wir uns immer wieder neuen Themen stellen und diese von der Perspektive des Evangeliums her durchdenken müssen. Ein spannendes Abenteuer!
3. Die Kraft des Evangeliums: Warum ist die gute Nachricht emotional beglückend?
Der postmoderne Mensch ist pragmatisch. Seine Frage lautet: Was hilft’s? Was macht mich glücklich?
Natürlich könnte man diese Frage aus theologischer Sicht gleich als falsche Frage abtun: zu utilitaristisch; man kann Gott nicht zum bloßen Wunscherfüller machen.
Stimmt! Trotzdem gebe ich zu bedenken: Hat Gott uns nicht in der Inkarnation vorgelebt, dass er sich um die wirklichen Fragen und Nöte der Menschen kümmert – allzu häufig auch jenseits von theologischen Richtigkeiten?
Oft bemerke ich eine große Scheu, darüber zu sprechen, was Jesus ganz konkret im Leben von einzelnen Menschen tut. Vielleicht, weil wir es selbst nicht erleben? Vielleicht, weil wir keine falschen Erwartungen wecken und enttäuschen wollen?
Heraus kommen oft theologische Richtigkeiten, die wenig mit dem Leben zu tun haben und darum nicht beim Hörer bzw. der Gesprächspartnerin ankommen. Es bleibt ein entkerntes, blasses Evangelium ohne Kraft, das zu Recht von unseren Zeitgenossen als irrelevant wahrgenommen wird.
Man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd herunterfallen: mit dem „Glücksevangelium“. Dessen Vertreterinnen und Vertretern halte ich zugute, dass sie die Frage nach Glück in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Dann aber wird dieses Glücksstreben „getauft“ und, grob vereinfacht, gepredigt: „Ja, ihr habt recht; Glück ist das oberste Ziel. Ja, dieses Glück ist jederzeit für jede Person verfügbar, die sich genug anstrengt und den richtigen Weg findet. Aber alle Wege der Gesellschaft sind falsch; Jesus ist der wahre Weg zum Wohlergehen. Ihr müsst also nur genug beten, genug Lobpreis machen, offen genug sein … Dann werdet ihr dauerhaft glücklich, denn das ist der Wille Gottes.“ Das führt zu immensem christlichem Leistungsdruck und lässt Menschen tief enttäuscht zurück, weil „das mit Jesus doch nicht funktioniert.“
Nicht Glück ist das Ziel und Jesus Mittel zum Zweck, sondern Gott selbst ist das Ziel. Ja, Leben mit ihm ist immer wieder eine beglückende Erfahrung, aber dieses Glück ist nur ein „Nebenprodukt“, nicht das Ziel an sich. Manchmal erfahren wir es, manchmal vermissen wir es schmerzlich. Und für viele in anderen Erdteilen führt gerade der Glaube an Jesus in ein Leben, das nach irdischen Standards nicht glücklich und erfolgreich ist.
Ja, Gott verspricht Leben in Fülle. Im hebräischen Denken aber schließt ein Leben in Fülle das ganze, pralle Leben mit ein: das Wandern im finsteren Tal genauso wie den Berg der Verklärung und den ganzen Alltag zwischendrin. Die Begegnung mit Jesus hilft uns, all das als Leben anzunehmen: Leben auch in der Tiefe zu finden, Schalom immer wieder auch in widrigen Umständen zu erleben, die goldenen Fäden im Alltag zu entdecken.
Damit befreit Jesus uns vom Glücks-Leistungsdruck und dem Gefühl, versagt zu haben, wenn unser Leben nicht eine dauerhafte Aneinanderreihung von strahlenden Insta-Post-Momenten ist. Schweres und Normales gehören zu unserem Leben, dürfen sein und sind in Gottes Weg mit uns eingeschlossen.
Gleichzeitig heißt das aber auch: Ja, das Leben mit Jesus hat Kraft; er verändert, deckt auf, heilt. Geschichten davon dürfen und sollen wir erzählen. Dabei ist es wichtig, dass wir ehrlich sind: Wo hilft mir der Glaube – und wo hilft er mir auch nicht? Wir sollten das Handeln Jesu an einer konkreten Person auch nicht zum Gesetz für alle machen; ihn auf dieses Handeln festlegen. Wie gut würde uns der Mut stehen, andere einzuladen: „So hat Jesus an Bartimäus, an Lisa oder an mir gehandelt. Lerne ihn kennen und schau, wie er dir begegnet.“
Vor einigen Wochen erzählte mir ein Rechtsanwalt in London, wie er Jesus kennengelernt hatte und zum Glauben gekommen war. Auf die Frage „Wie hat Jesus Ihr Leben verändert?“ zögerte er kurz und sagte dann: „Um ehrlich zu sein: Vorher war mein Leben grau. Jetzt ist es bunt!“
Als Aussage einer Predigt hätte ich das als unheimlich platt und verkürzt empfunden. Aus seinem Mund aber, als Zeugnis seiner Erfahrung, hat mich die Schönheit, die Wahrheit und die Kraft der Guten Nachricht neu begeistert.